Gibt es faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie?
„Des isch jo Made in China!“ Solche Sätze – du kannst auch China etwa durch Bangladesch austauschen – fallen schnell beim Blick ins Etikett deiner Kleidungsstücke. Doch welche Arbeitsrealität steckt eigentlich hinter den oft sehr günstigen Preisschildern mit solchen Aufschriften? Wir werfen einen Blick auf schlechte und faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie.

Wer macht eigentlich unsere Lieblingsstücke?
Die Antwort auf diese Frage ist oft komplizierter, als gedacht. Denn hinter einem einfachen T-Shirt können Dutzende Hände stecken – von der Baumwollernte über das Spinnen, Weben, Stricken und Färben bis hin zum Nähen und Verpacken. Wir haben dir ein einem anderen Blogartikel schon einmal die Reise eines Schwabenpower-Kleidungsstücks erklärt. Dort siehst du, wie viele Schritte im Produktionsprozess passieren.
Was bei uns aus fair produzierter und geernteter Bio-Baumwolle später in einem Umkreis von 50 Kilometern passiert, ist bei Fast Fashion oft anders. In vielen Fällen geschehen viele Schritte wenig überraschend nicht in Deutschland oder Europa, sondern in Ländern wie Bangladesch, Vietnam oder Indien. Deutschland importiert die meiste Kleidung aus China.
Weltweit arbeiten viele der rund 60 Millionen in der Textilindustrie beschäftigten Menschen – oft Frauen – unter schwierigen Bedingungen in riesigen Textilfabriken, um unsere Mode zu nähen. Und das meist für einen Lohn, von dem sie kaum leben können.
Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie?
Die Arbeitsrealität in der Textilindustrie ist in vielen Produktionsländern alles andere als rosig. Während wir also gemütlich durch Online-Shops scrollen, schuften andere oft 10 bis 14 Stunden täglich bei schlechter Belüftung, mit wenigen Pausen und ohne gesicherten Arbeitsschutz. Dabei oft leider an der Tagesordnung:
- Kinderarbeit
- gesundheitliche Risiken
- fehlende Arbeitsrechte
- Akkordarbeit
- Überstunden
- unsichere Fabrikhallten
Klar ist: Unsere Kleidung hat einen Preis – und wenn der an der Kasse niedrig ist, zahlen andere dafür umso mehr.
In Ländern wie Bangladesch etwa liegt der Mindestlohn mit 106 Euro monatlich oft weit unter dem, was die Menschen zum Leben brauchen. Sogenannte „Living Wages“, also Gehälter, die das eigene Leben adäquat ermöglichen, bleiben Wunschdenken – in Bangladesch wären das zum Beispiel 291 Euro.

Was bedeutet „faire Textilproduktion“ überhaupt?
Dass die aufgezählten Arbeitsbedingungen und der Lohn nicht fair sind, dürfte klar sein. Für uns heißt faire Textikproduktion: Alle Menschen entlang der Lieferkette arbeiten unter guten Bedingungen und werden fair bezahlt – vom Baumwollfeld bis zur letzten Naht. Was das konkret bedeutet:
- Faire Löhne: Die Beschäftigten erhalten einen Lohn, der zum Leben reicht – nicht nur das gesetzliche Minimum wie etwa in Bangladesch.
- Sichere Arbeitsbedingungen: Keine einsturzgefährdeten Gebäude, die Katatrophen wie 2013 in Savar ermöglichen, keine giftigen Chemikalien ohne Schutz, keine 14-Stunden-Schichten.
- Recht auf Mitbestimmung: Gewerkschaften sind erlaubt, und die Beschäftigten können ihre Interessen vertreten – ohne Angst vor Entlassung.
- Keine Kinderarbeit: Selbstverständlich sollte es sein, ist es aber leider nicht. Faire Produktion schließt Kinderarbeit aus!
- Verlässliche Arbeitszeiten: Pausen, geregelte Arbeitszeiten und Überstunden nur mit Zustimmung.
- Transparente Lieferketten: Nur wer offenlegt, wo und wie produziert wird, kann auch glaubwürdig faire Bedingungen garantieren.
Als Orientierung für Verbraucher können Siegel wie Fairtrade, GOTS (Global Organic Textile Standard), IVNbest oder SA8000 dienen. Sie helfen dir dabei, faire Produktionen zu erkennen – aber auch hier lohnt sich ein zweiter Blick, denn nicht jedes Siegel hält, was es verspricht. In unserem Artikel zum Öko-Tex-Siegel erfährst du mehr dazu.
4 Tipps, wie du deinen Teil zu fairen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie beitragen kannst
Du musst kein Weltverbesserer sein, um die Welt ein bisschen besser zu machen – es reichen oft schon kleine und vor allem bewusste Entscheidungen beim nächsten Shopping-Tag.
Mit diesen vier Tipps trägst du aktiv dazu bei, dass faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie gefördert werden:
- Weniger, aber besser kaufen: Qualität vor Quantität! Lieber langlebige Lieblingsstücke statt schnelle, unfair produzierte Klamotten.
- Siegel-Check: Achte beim Einkauf auf die erwähnten Textilsiegel wie GOTS, IVNbest, Fairtrade oder SA8000. Noch besser: Informiere dich, was genau dahintersteckt.
- Unterstütze faire Marken: Kaufe bei Labels, die sich ehrlich für faire Produktion einsetzen – zum Beispiel bei Schwabenpower oder anderen schwäbischen Modemarken.
- Mitdenken: Du bist dir unsicher, woher ein Teil kommt oder wie es produziert wurde? Frag nach! Direkt beim Label oder im Laden. Je mehr Menschen nachhaken, desto größer wird der Druck auf die Branche, fairer zu werden.
Und, der natürlich beste Tipp zum Abschluss: Kaufe deine Lieblingsstücke bei Schwabenpower. Hier unterstützt du nicht nur faire Arbeitsbedingungen, sondern auch die Region und echte Handarbeit!

Fazit: Mehr Verantwortung in der Mode
Faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sollten der Standard sein, auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg zu sein scheint. Mit jedem Kauf entscheiden wir an der Kasse, welches System du unterstützt – Ausbeutung vs. Fairness.
Bei Schwabenpower setzen wir uns dafür ein, dass dir deine Lieblingsstücke nicht nur optisch gut gefallen, sondern auch unter guten Bedingungen entstehen. Regional, transparent, mit Respekt für Mensch und Umwelt. Schau doch mal vorbei!
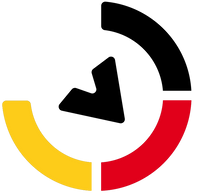

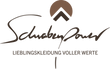

Hinterlassen Sie einen Kommentar